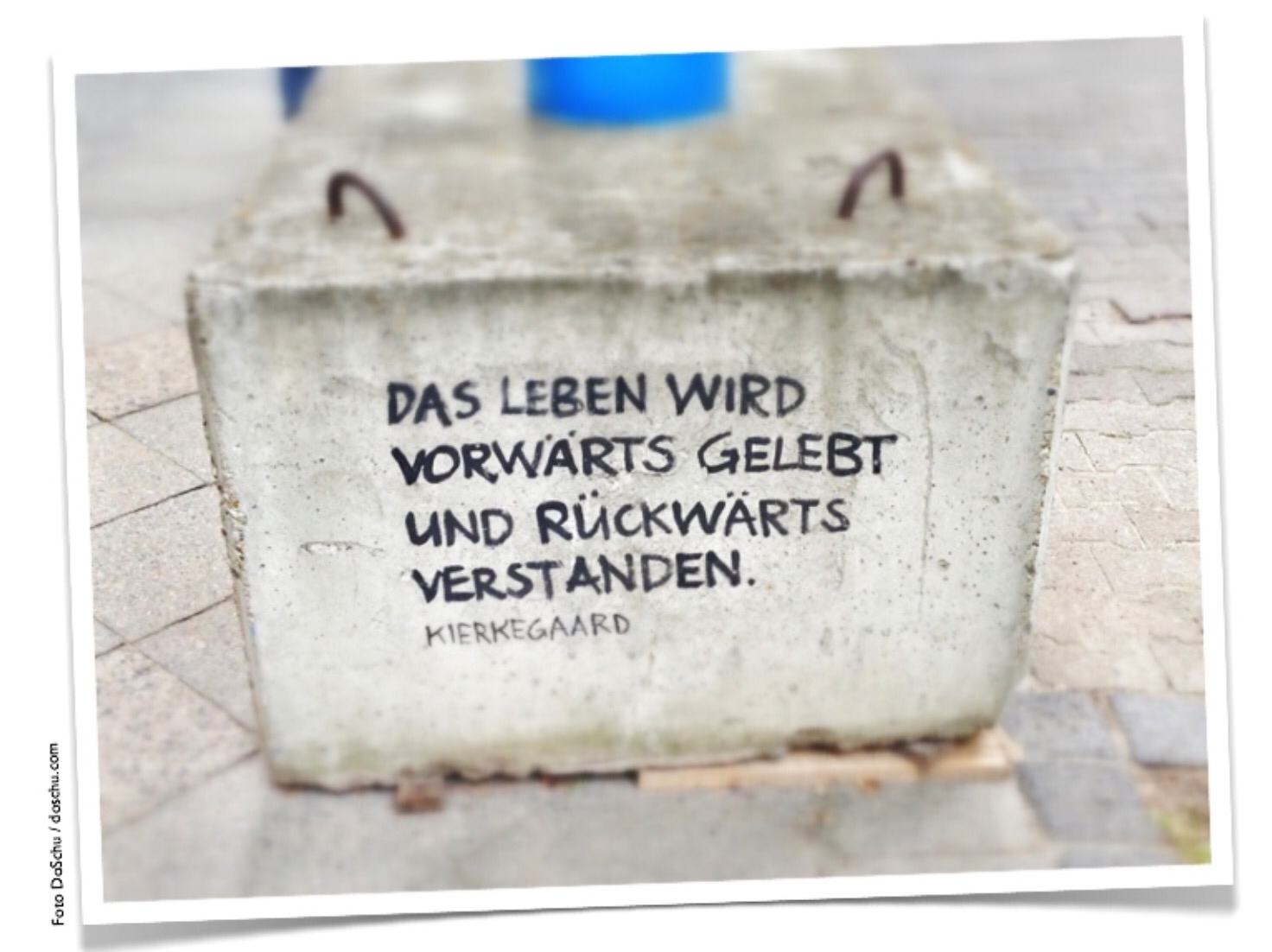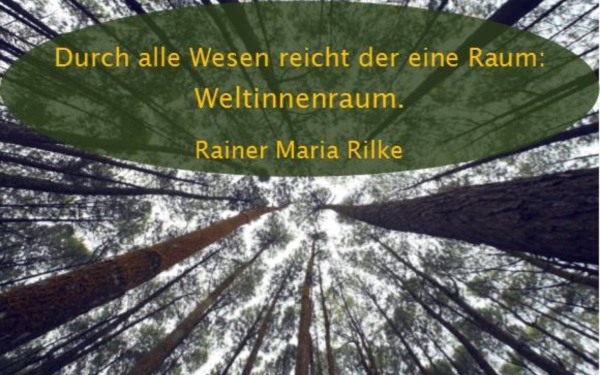Was tut ein Mensch, der in Treibsand geraten ist? Natürlich: er will sich befreien. Er strampelt mit den Beinen, rudert mit den Armen – und bringt sich damit immer mehr in Schwierigkeiten.
Was würde helfen? Innehalten, Ruhig-Werden und sich ganz flach hinlegen. So kann er dann langsam auf tragfähigen Boden robben.
Dies verdeutlicht, welche Fehler Menschen oft machen, die mit belastenden Dingen, also emotionalen Triebsand fertig werden wollen. Mit quälenden Fragen wie „Warum musste mir das passieren?“ oder „Warum hat man mir das angetan?“ suchen sie Erklärungen, hoffen auf eine Befreiung von der seelischen Last… und erreichen das Gegenteil: Demütigungen, Kränkungen, Niederlagen, Fehler bleiben gerade dadurch in der Erinnerung lebendig. Der Versuch, das Erlebte „rückwärts“ zu erklären, verbaut ihnen häufig die Chance, befreit „vorwärts“ zu leben.
Wenn wir versuchen, über Enttäuschungen und Kränkungen (oder auch eigenes Versagen) hinwegzukommen, machen wir einen grundlegenden Fehler: Wir sind zu nah dran. Wir hören die beleidigenden Worte des Freundes. Wir sehen sein verächtliches Gesicht. Wir spüren erneut die Demütigung, die Beschämung. Diese selbstzentrierte Art, über Zurückliegendes nachzudenken, hält uns in der Negativität gefangen.
Mit einer einfachen Möglichkeit kann man in solchen Situationen innerlich etwas zurücktreten, um sich aus gewisser Distanz anzuschauen:
Man kann sich vorstellen, dass man sich selbst aus der Perspektive einer Fliege an der Wand betrachtet – man nennt dies auch die „fly on the wall“-Perspektive.
Statt über das „Warum“ nachzugrübeln, ermöglicht die distanzierte Sichtweise eine neutrale Beschreibung: „Was ist geschehen?“ Der Freund, dessen Bemerkung uns gekränkt hat, war durch extreme Arbeitsüberlastung gestresst. Er hatte sich nicht unter Kontrolle. Das war nicht schön, ist aber verständlich…

Hierhin gehört auch ein Gedanke zu den grasierenden Selfies: Auch hier muss man aufpassen, dass man damit nicht immer und immer wider die eigenen Bilder von sich wiederholt, sich nur immer um sich selbst dreht und damit Dinge, wie Selbstverwirklichung, Egoismus, Leistungsdenken und Geltungssucht festigt. Ich denke viel mehr zu unserer Entfaltung und in die Weite führen uns Dinge, wie Demut, Hingabe, Gemeinschaftssinn und Spiritualität.
Ja, es ist wichtig, mit sich im Guten zu sein, gut für sich zu schauen, sich an erste Stelle zu bringen. Aber der Egoismus und die Selbstverwirklichung sollten nicht einen übergrossen Raum im eigenen Leben einnehmen, damit die Weite in und um uns dabei nicht verloren geht. Die „fly on the wall“- Methode ist ein ideales Werkzeug, die momentane Egozentrierung (in der Treibsandsituation) etwas zu lockern und uns somit neue Perspektiven zu öffnen.
Auch führt das Innehalten, Ausatmen, Nach-Innen-Reisen viel weiter. Mit der fly-on-the-wall Haltung nimmst Du das Aussen wahr und damit auch das Spiegeln in deinem Innern.
Reisen nach innen und immer wieder Innehalten helfen gut, mit sich selbst gut unterwegs zu sein, sich aber doch auch nicht als zu wichtig zu nehmen und der Selbstverwirklichung etwas weniger Kraft zu geben. Das ermöglicht Abstand von Sich-im-Kreis-zu-drehen und hilft uns gleichzeitig mehr in der Hingabe, der Spiritualität zu sein.
Löst man sich mehr und mehr von starken Bildern, die man in sich trägt, ist die Möglichkeit stets offen, sich immer wieder neu zu entdecken und neu zu finden, so wie wir es vielleicht nie erwartet hätten.
„Erlaube dir in inniger Bezogenheit, dich von deinen Vorstellungen über dich und das Leben zu lösen, auf das du dich jeden Tag neu kennen lernst und überraschen lässt von nie Gedachtem.“
(Vielen Dank an Psychologie Heute und Ursula Nuber, die ich hier teilweise zitiert habe – und herzlichen Dank an die kreative Mitarbeit von Franziska B.)
Ich fühle, also stimmt es – die grosse Selbsttäuschung
Die Welt wird immer gefühlsbetonter. Was auf den ersten Blick gar nicht so schlecht tönt, birgt Gefahren: Wenn Gefühle wichtiger sind als Fakten, darf man in allen Lebenslagen einfach seinem Gefühl folgen. Es gibt dann keine Biodiversitätskrise, wie jüngst der Bundesratskandidat Markus Ritter erklärte – da er das so empfand. Mit diesen und anderen bedrohlichen Auswüchsen der Selbsttäuschung befasst sich Daniel Strassberg in seiner Philosophie-Kolumne. Dabei geht er zurück bis ins 17. Jahrhundert. Schon damals wurde diese Gefahr erkannt.
„Die 68er, vor allem die Hippiebewegung, nahmen diese These auf und feierten, um dem kalten Kapitalismus etwas entgegenzusetzen, den Einzelnen und seine Gefühle. Make love, not war! war ihr allgegenwärtiges Motto.
Diese Aufwertung und Idealisierung der Gefühle war nur möglich geworden, weil man die Errungenschaften der Aufklärung für garantiert und unhintergehbar hielt. Doch man schüttete das Kind mit dem Bade aus: Man hatte nicht bemerkt, dass die Ersetzung der Wissenschaft durch die Liebe die Basis der gesellschaftlichen Verständigung allmählich zerstörte. Make science, not war! war, wenn auch nicht explizit, das Motto der wissenschaftlichen Revolution gewesen, um die gemeinsame Grundlage der Verständigung zu erhalten und so den Krieg zu verhindern. Man hatte mit anderen Worten nicht gesehen, dass der Verzicht auf rationale Begründungen der Täuschung und vor allem der Selbsttäuschung Tür und Tor öffnet.
Sie wollen sich lediglich über die Begründungspflicht, die Grundlage der Aufklärung und der Demokratie, lustig machen: Ich kann jeden Schwachsinn erzählen, ich muss nichts begründen, weil ich die Macht dazu habe! Das ist die eigentliche Botschaft. Trump hat ja behauptet, er können auf der 5th Avenue in New York jemanden erschiessen und käme damit durch. Es ist zu befürchten, dass er recht hat.
An die Stelle der rationalen Begründung tritt die Spiegelung der Gefühle in Foren, Chatrooms und auf Social Media. Wo Begründungen fehlen, müssen die Gefühle dauernd bestätigt werden: Mein Gefühl ist wahr, weil es mein Gefühl ist und von vielen anderen geteilt wird. In allen politischen Lagern beobachten wir die Ersetzung der Begründungspflicht durch das massenhaft gespiegelte Gefühl. Dass es nicht mehr darum geht, Probleme zu lösen – vielleicht, weil sie unlösbar geworden sind –, sondern die Gefühle mit anderen zu teilen, hat Francis Bacon bereits im 17. Jahrhundert erfasst: „Für Lehren, welche sich auf vorgefasste Meinungen und Ansichten stützen, ist der Gebrauch der Antizipationen und der Dialektik gut, denn hier kommt es darauf an, die Zustimmung zu erzwingen, nicht aber die Dinge zu meistern.“ (Francis Bacon: «Novum Organum» Bd. 1. Aphorismus 29)
Von der Inthronisierung des gemeinsamen Gefühls als oberste Wahrheitsinstanz zu Gewalt und Krieg sind es nur wenige Schritte.“
(Dani Strassberg in der Republik, 11.03.25)
Weiterlesen: Nimm Dich nicht so ernst >>>
Letzte Aktualisierung von Dr. med. Thomas Walser:
11. März 2025