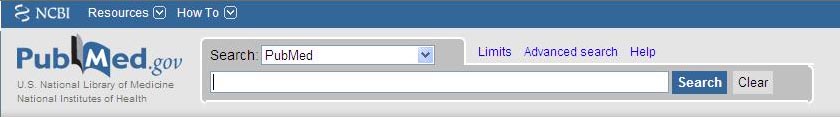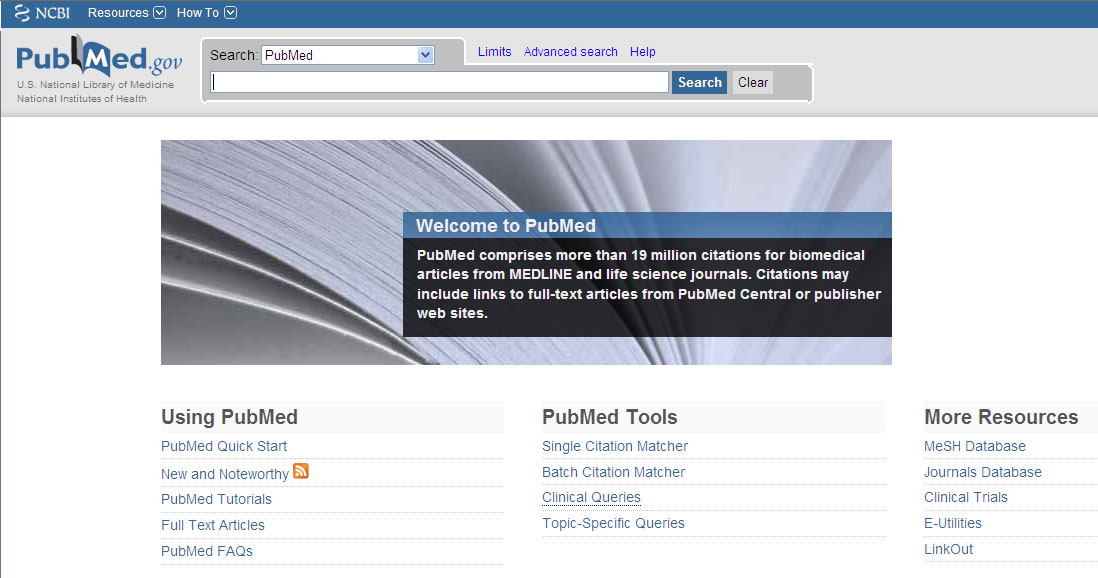Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände
Mit “Resilienz” wird in der psychologischen Forschung die psychische und physische Stärke bezeichnet, die es Menschen ermöglicht, Lebenskrisen, wie schwere Krankheiten oder auch ein Burnout ohne langfristige Beeinträchtigungen zu meistern. Kurz: Gedeihen trotz widriger Umstände.
Resilienz ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch lernen kann. Je früher er sie erwirbt, um so besser. Am leichtesten in den ersten zehn Lebensjahren. Doch auch Erwachsene sind zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens grundsätzlich in der Lage, ihre Widerstandsfähigkeit zu schulen.
Resiliente Menschen kann man mit einem Boxer vergleichen, der im Ring zu Boden geht, ausgezählt wird, aufsteht und danach seine Taktik grundlegend ändert (resilience = englisch: Elastizität, Spannkraft – “resilire”, lat. abprallen). Resilienz wurde auch schon “the mental muscle everyone has” genannt oder das “Immunsystem unserer Seele”.
Die Resilienz lässt sich in drei Subtypen mit verschiedenen Bewältigungsszenarien unterteilen. Das Bild eines Baums, der heftigem Wind ausgesetzt ist, verdeutlicht sie: Ein massiver Stamm kann den Sturm unbeschadet überstehen – das ist Resistenz. Vielleicht wird der Baum auch durchgeschüttelt und die Äste verbiegen sich, nehmen danach jedoch wieder ihre alte Form ein. Dann spricht man von Regeneration. Möglich ist aber auch, dass die Äste dauerhaft ihre Wuchsrichtung ändern, um künftigen Stürmen weniger Angriffsfläche zu bieten. Diese Resilienzstrategie heisst Rekonfiguration.
Wir können mit dem, was das Schicksal einem antut, gut oder schlecht umgehen. Der Resiliente hat beschlossen, gut damit umzugehen.
Wie lernt man dies?
Man weiss eigentlich noch zu wenig darüber. Doch die meisten Forscher gehen von einer Wechselwirkung zwischen individuellen Möglichkeiten und sozialen Angeboten aus. Ruhiges Temperament und eine höhere Intelligenz scheinen resilientes Verhalten zu begünstigen. Sicher ist, dass vor allem die Zugehörigkeit zu einen grösseren Verbund von Menschen, der über die Familie hinausgeht, für die Herausbildung von Resilienz wichtig ist. Man sollte eingebettet sein. Resiliente Kinder haben sehr viel mehr Unterstützung von religiösen Gemeinschaften, von Nachbarn, Freunden, Lehrern und Verwandten, wie zum Beispiel Grossmüttern, erhalten. Die Familie kann, aber muss dabei keinen hohen Stellenwert haben.
Die Annahme, dass einmal gemachte schlechte Erfahrungen das gesamte weitere Leben prägen, wird durch die Resilienzforschung für viele Fälle widerlegt. Auch wenn in Kindheit und Jugend keine resilienzfördernden Erfahrungen gemacht werden konnten, muss niemand sich seinem Schicksal hilflos ausgeliefert fühlen. Resilienz kann in jedem Lebensalter erlernt werden. In ihrer Broschüre The road to resilience nennt die Amerikanische Psychologenvereinigung (www.apahelpcenter.org) zehn Wege, die zum Ziel führen (hier):
- Resiliente Menschen akzeptieren die Krise und die damit verbundenen Gefühle. Sie lassen sich Zeit. Sie wissen: Weglaufen hilft nicht. Es wird eine Zeit kommen, dann werden sie wissen, was zu tun ist. Bis dahin suchen sie sich einen Ort, an dem sie wohl fühlen, und lassen dort ihren Gefühlen freien Lauf.
Resiliente Menschen schämen sich nicht ihrer Tränen, ihrer Wut, ihrer Ängste. Sie reissen sich nicht zusammen und versuchen nicht, ihre Gefühle einzufrieren. Sie sorgen für sich selbst.
. - Resiliente Menschen suchen nach Lösungen. Sie glauben an die eigene Kompetenz. Sie verlassen die Opferrolle und werden aktiv:
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, auf Krisen zu reagieren. Man kann klagen: “Warum passiert gerade mir das? Womit habe ich das verdient? Wie konnte das geschehen? Es ist so schrecklich, das überstehe ich nicht!” Man kann aber auch sagen: “Ich habe nicht erwartet, dass mir so etwas Schreckliches widerfährt. Aber nun ist es geschehen, es liegt nicht in meiner Macht, es ungeschehen zu machen. Vor mir liegt eine äusserst schwierige und schmerzhafte Zeit – was kann ich tun, damit es mir gelingt, sie zu meistern?”
Resiliente Menschen, so zeigt die Forschung, wählen die zweite Möglichkeit. Sie grübeln nicht unentwegt über ein Problem nach, sind keine “Jammerlappen”, sondern sind sogar im tiefsten Schmerz in der Lage, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. “Wir können nicht beeinflussen, was mit uns geschieht, aber wir können entscheiden, welche Folgen das Geschehene für uns hat” (vergleiche mit dem Kohärenzgefühl der Salutogenese!).
. - Resiliente Menschen lösen ihre Probleme nicht allein. Sie bauen auf ihre sozialen Kontakte:
Ein ganz wichtiges Merkmal der Resilienz ist, dass krisengebeutelte Menschen bereit sind, mit anderen über ihre Sorgen zu sprechen. Resiliente Menschen versuchen erst gar nicht, ihre Schwierigkeiten im Alleingang zu lösen. Wie psychologische Studien übereinstimmend belegen, wird mit Schicksalsschlägen besser fertig, wer in eine Familie eingebunden ist oder ein festes soziales Netz von Freunden besitzt. Das gilt für Kinder wie für Erwachsene. Dabei achten Resiliente darauf, dass sie sich in ihrer Not an die richtigen Personen wenden. Sie suchen sich Menschen, die sich nicht von ihren Gefühlen verunsichern lassen, die einfühlend und unterstützend sind, die ihnen Mut machen und sie an ihre Stärken erinnern. Sie meiden Menschen, die nur Sprüche klopfen à la “Die Zeit heilt alle Wunden”, “Du musst stark sein, schon wegen der Kinder”, “Es lohnt nicht, über verschüttete Milch zu weinen” , “Anderen geht es noch schlechter als dir”, “Das Leben geht weiter” oder “Wenn ich irgend etwas für dich tun kann, ruf mich an”.
. - Resiliente Menschen fühlen sich nicht als Opfer:
Menschen, die mitten in einer Krise stecken, machen die Situation oft durch ihre Einstellung noch schlimmer, als sie ohnehin schon ist. Sie haben jegliche Hoffnung auf Änderung verloren, sehen nur noch alles grau in grau und betrachten sich als Opfer der Situation.
Häufig benutzen sie Formulierungen wie “Ich kann nicht”, “Niemals mehr werde ich glücklich sein”, “Warum nur ist das Leben so ungerecht zu mir?”, “Ich weiss nicht, was ich tun soll”.
Auch resiliente Menschen sind nicht gegen das Opfergefühl gefeit. Doch nach einer gewissen Zeit gelingt es ihnen, anders über ihre Situation zu denken. Statt “Ich kann nicht” zu sagen und damit dem Gefühl Ausdruck zu verleihen, völlig die Kontrolle über das Geschehen verloren zu haben, sagen sie “Ich will es versuchen…”.
. - Resiliente Menschen bleiben optimistisch. Krisen werden nicht als unüberwindliches Problem betrachtet:
Eine optimistische Lebenseinstellung ist das wichtigste Merkmal der Resilienz. Ohne die feste Überzeugung, dass irgendwann, früher oder später, sich die Dinge wieder zum Positiven wenden werden, ist Widerstandsfähigkeit nicht denkbar. Dieser gesunde Optimismus darf nicht mit positivem Denken verwechselt werden. Positives Denken verleugnet die Realität, will die negativen Ereignisse schönreden. Optimistisches Denken dagegen ist kein Wunschdenken, es erkennt die Realität an, geht aber davon aus, dass negative Ereignisse, gleich welcher Art, eine befristete Angelegenheit sind und es auch wieder bessere Zeiten geben wird.
Ein weiteres Merkmal optimistisch denkender Menschen: Sie verallgemeinern nicht. Wenn sie eine Niederlage einstecken müssen, dann denken sie nicht “Ich tauge nichts”, sondern: “Diesmal hatte ich keinen Erfolg, das nächste Mal wird es wieder klappen”.
Martin Seligman ist überzeugt davon, dass jeder Mensch optimistisch denken lernen kann, je früher, desto besser. Deshalb hat er ein Programm entwickelt, das Eltern und Lehrern Anleitungen an die Hand gibt, wie sie Kinder zu optimistischem, resilientem Denken erziehen können (Martin E.P.Seligman, Kinder brauchen Optimismus, Rowohlt Verlag). Hier hat jeder Erziehende/Lehrer eine eigentliche Verpflichtung und kann mit seinem Handeln im alltäglichen Umfeld dazu beitragen, dass das Kind Vertrauen in die eigene Kraft und die eigene Fähigkeiten gewinnt, dass es sich selbst als wertvoll erlebt und dass es durch seine eigenen Handlungen Veränderungen bewirkt. Kernpunkte der Resilienz (wie: – Suche dir einen Freund und sei anderen ein Freund. – Fühle dich für dein Verhalten verantwortlich. – Glaube an dich selbst.) sollen Kindern beigebracht werden.Resilienz hat auch gar nichts mit dem modernen Hype des “Manifestieren” zu tun. Das Konzept des Manifestierens beschönigt die gleiche verblendete Logik, die behauptet, Armut sei eine Wahl, und die vielen politischen Desinformationen zugrunde liegt. Wenn die Realität nur das ist, was wir aus ihr machen, dann werden die Skrupellosesten die meiste Macht haben, die Zukunft zu gestalten.
Weiterlesen >>> - Resiliente Menschen geben sich nicht selbst die Schuld:
Am Beginn einer Krise sind Schuldgefühle fast unvermeidlich. Die Betroffenen quälen sich mit Selbstvorwürfen. “Hätte ich nur nicht soviel gearbeitet, dann wäre sie heute noch bei mir”, “Wenn ich ihm nur nicht erlaubt hätte, Motorrad zu fahren … “”,Wäre ich nur aufmerksamer gewesen”. Resiliente Menschen unterscheiden sich jedoch von anderen dadurch, dass sie ziemlich bald diese Selbstanklagen beenden und ihren eigenen Anteil an der Krise realistisch einschätzen. Sie erklären sich das Geschehen nicht mehr ausschliesslich internal (“ich allein bin schuld”), sondern erkennen auch, was andere oder die Umstände dazu beigetragen haben. je mehr es gelingt, externe Faktoren verantwortlich zu machen, desto geschätzter ist das eigene Selbstwertgefühl, desto grösser die Chance, über einen Schicksalsschlag schneller hinwegzukommen.
Der Münchner Psychologe Dieter Frey konnte dies in Studien mit Unfallopfern belegen. Zwei Tage nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus wurden die Patienten gefragt: Wer ist schuld am Unfall? Wäre er vermeidbar gewesen? Glauben Sie, Ihre Genesung beeinflussen zu können? Das Ergebnis: Patienten, die ihrer Situation eine positive Seite abgewinnen konnten und glaubten, nicht selbst schuld am Unfall zu sein, erholten sich schneller von ihren Verletzungen als Unfallopfer, die mit ihrem Schicksal haderten (“Warum gerade ich?”) und den Unfall für vermeidbar hielten. Diese Menschen brauchten im Schnitt 140 Tage, ehe sie ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten, während die optimistischen bereits nach 80 Tagen an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten.
- Resiliente Menschen planen voraus. Sie nehmen eine Langzeitperspektive ein und entwickeln realistische Ziele:
Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass Ihr Arbeitsplatz irgendwann gefährdet sein könnte? Halten Sie es für möglich, dass Ihre Ehe scheitert? Was ist, wenn Ihr Vermieter Ihnen kündigt und Sie umziehen müssen? Sind Sie vorbereitet aufs Älterwerden? Resiliente Menschen, so zeigt die Forschung, halten nichts für selbstverständlich. Sie rechnen mit den Wechselfällen des Lebens und beschäftigen sich gedanklich damit. Die Frage “Was wäre, wenn…” stellen sie sich auch in Zeiten, in denen noch kein Anlass zur Sorge besteht. Auf diese Weise sind sie auf die “vorhersehbaren Veränderungen” im Leben vorbereitet, zu denen nach dem Psychiater Frederic Flach (Resilience. The Power to Bounce Back When the Going Gets Tough!, New York 1997) vor allem bestimmte Zäsuren und Übergangsphasen gehören: Heirat, die Geburt eines Kindes, der Tod der eigenen Eltern, Berufswechsel, Scheidung, Älterwerden. Resiliente Menschen werden von diesen Wendepunkten des Lebens und den damit verbundenen Problemen nicht völlig überrascht, weil sie sich gedanklich darauf vorbereiten.
Auch H. Norman Wright (Resilience. Rebounding When Life’s Upsets Knock You Down, Michigan 1997) ist überzeugt davon, dass vorausplanendes Krisenmanagement die Resilienz stärkt. Seiner Ansicht nach müsste beispielsweise so manche Ehe nicht vor dem Scheidungsrichter enden, wenn sich die Paare mit den Problemen und Herausforderungen beschäftigen würden, die im Laufe des Zusammenlebens auftreten können. Auch Paare, die sich ein Kind wünschen, können durch Vorausplanung vielen Krisen der Elternschaft die Schärfe nehmen. Und Menschen, die sich mit den Facetten des Älterwerdens auseinandersetzen, bewältigen die damit verbundenen Veränderungen besser.
Resilienz, die Elastizität eines Bungeebandes, benötigen wir nicht nur wenn schlimme Ereignisse uns auf eine schwere Probe stellen. Resilienz ist auch ein wichtiger Schutz vor Alltagsstressoren, die immer zahlreicher und intensiver auf uns einwirken. “Es ist eine Sache, durch Zeiten der Unsicherheit und Instabilität zu gehen, wenn die Welt um uns herum einigermassen stabil ist”, meint Frederic Flach. “Aber es ist etwas völlig anderes, wenn die Veränderungen um uns herum immer zahlreicher werden und sich ganze Gesellschaften im Umbruch befinden.”
Noch ist das Scheitern “das grosse moderne Tabu ” , wie der Soziologe Richard Sennett schreibt. “Wie wir mit dem Scheitern zurechtkommen, wie wir ihm Gestalt und einen Platz in unserem Leben geben, mag uns innerlich verfolgen, aber wir diskutieren es selten mit anderen.” Die Ergebnisse der Resilienzforschung sind ein erster wichtiger Schritt, dieses Tabu zu brechen.
( Ursula Nuber “Psychologie Heute” (Mai 1999 und Sept.05) )
Resilienzkritik
Was in der momentanen Resilienzbegeisterung ausgeblendet wird, sind ihre zwiespältigen impliziten Botschaften, so die Handlungsfähigkeit durch Selbstoptimierung – suggeriert wird damit die Idee von Bemeisterung und Kontrolle. In der Vorstellung einer solchermassen smarten Anpassung geraten die eigentlichen Ursachen und Hintergründe der Resilienzerfordernisse aus dem Fokus. Die Verantwortung für das Zurechtkommen in einer sozial gefährdeten und massiv bedrohten Ökosphäre wird an die Einzelnen verschoben. Fragen nach dem wirtschaftlichen und politischen Kontext dieser Bedrohungen und nach deren Verantwortlichen verschwinden. Sollten wir aktuell vielleicht eher rebellisch statt resilient leben und damit die systemischen Ursachen der sozialen und ökologischen Krisen infrage stellen?
Zudem: Angst, Schwäche und Hilflosigkeit kommen im Resilienznarrativ nicht vor. Der zukunftsfähige Mensch hat sich erfolgreich angepasst und verantwortet sein seelisches Überleben scheinbar allein. Muss sich schämen, wem dies nicht gelingt? Was geschieht, wenn wir vom Bedürfnis nach Überlegenheit und Kontrolle um jeden Preis loslassen?
Resilienz bedeutet aber noch etwas: einen Lernprozess zu durchlaufen. Und der basiert immer auf Transformation. In der Suche nach Neu-Anpassung verändern wir uns, unsere Sicht auf und unseren Bezug zur Welt. Jenseits der Selbstoptimierungslogik eröffnet sich ein Feld kritischer Kreativität. Können wir in gemeinsamer Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Krisen lernen, unser Zusammenleben mit und auf diesem Planeten neu, anders und vor allem besser zu gestalten? So verstanden – ein Tusch auf die Resilienz!
(Vera Kattermann in Psychologie Heute, 01/2024)
Burnout
Burnout umfasst eine tiefe Identitätskrise, die oftmals ihren Ursprung in zu hohen Erwartungen an eine Situation hatte. Die letztendliche Totalerschöpfung ist das sozial akzeptierte Zeichen nach aussen, dass etwas nicht stimmt. Burnout ist allerdings mehr als Erschöpfung, die auch entstehen kann wenn man wegen Termindruck drei Wochen durcharbeitet oder fünf Freunden am Stück beim Umzug hilft. Burnout entsteht früher und geht tiefer. Wer selbst noch in der Lage ist, die Reissleine zu ziehen und aktiv Dinge zu tun, die einem gut tun, ist zum Glück noch ein Stück vom Burnout entfernt.
Fabienne Riener hat in diesem wunderbaren Text aufgeschrieben, wie Burnout entsteht, meistens nicht von drei Nachtschichten in einer Woche, sondern eher dann, wenn man lange auf ein Ziel hinarbeitet und regelmässig seine Grenzen überschreitet. Ein spannender Text, den alle lesen sollten, die öfter mal länger arbeiten.
Mehr über das Burnout hier >>>
Krisen? Verlust?
Zurzeit sind wir bereits in fünf Krisen gefangen: Artensterben, Klimakrise, Pandemie, der russische Angriffskrieg und die millionenfache Flucht aus der Ukraine. In zwei weitere bewegen wir uns hinein: Schon begonnen hat eine globale Nahrungsmittelknappheit, die aller Wahrscheinlichkeit nach noch mehr Flüchtende nach Europa bringen wird, diesmal von Süden, da, wo demnächst gehungert wird. Das sind dann sieben Krisen, und da reden wir noch nicht von der Inflation, von der Krise der Globalisierung oder der westlichen Demokratien.
In Anbetracht dieser Angriffe auf unsere Resilienz, wie sollen wir zuversichtlich bleiben?
Ich habe in letzter Zeit über das Verlieren nachgedacht und darüber, wie sehr es ein integraler Bestandteil unserer gesamten Vorstellung vom Universum – und vor allem von Krisen ist. Ich bin ständig am Verlieren. Ich verliere Vitalität. Ich verliere Würde. Ich verliere Geld. Ich verliere meine Jugend. Ich verliere meinen Hund, und langsam, unausweichlich verliere ich meinen Verstand. Irgendwo habe ich gelesen: “Was das Ego zu verlieren fürchtet, ist der Verlust selbst.” Das Ego gedeiht, indem es sich am Verlust labt. Jedes Mal, wenn es mich davon überzeugen kann, zu glauben, dass ich etwas oder jemanden verloren habe, verstärkt es die Idee der Trennung; und was ist das Ego anderes als die Idee der Trennung?
Könnten wir gemeinsam damit beginnen, die Grundvoraussetzung der Idee des Verlustes zu hinterfragen? Wie würden wir dann “äussere” Ereignisse wie die Pandemie unserer Zeit oder das Ableben eines geliebten Menschen erleben?
Es gibt dabei einige Hindernisse, die im Wege stehen. Das erste ist, dass ich zutiefst süchtig nach allen Gefühlen bin, die mit Verlust verbunden sind. Ich werde “entziehen” müssen. Wie einige von euch wissen, macht eine Entzug keinen Spass, und sie ist auch nicht angenehm. Die zweite Herausforderung könnte darin bestehen, dass ich die Gültigkeit des breiten Spektrums von Gefühlen in Frage stellen muss, die von der Gesellschaft sanktioniert werden, wenn es um Verlust geht, und dabei könnte es so aussehen, als würde ich meine Menschlichkeit in Frage stellen. Das tue ich. Ist es nicht an der Zeit, unsere menschliche Verkleidung zu durchschauen und unsere “unveränderliche Göttlichkeit” zurückzufordern?
Die Zehn Gebote als Krisenprophylaxe
Peter Modler beschreibt in seinem Buch “Die Königsstrategie – so meistern Männer berufliche Risiken” realitätsnah den “selbstmörderischen Luxus” vermeintlicher Souveränität, aber auch, wie es Managern gelingen kann, die “persönliche Resettaste” zu drücken.Dies ist spätestens dann nötig, wenn die Herausforderungen der Arbeit die persönlichen Bindungen in der Partnerschaft, zu Familie, Freunden und selbst zum eigenen Körper zerstören und die Brücken zum Leben jenseits der Arbeit brechen.
Die Empfehlungen des Autors fassen sich am besten zusammen in den “Zehn Geboten des Königs”:
- Du sollst auf die kleinen Fehler achten!
- Du sollst keine Angst haben vor einem Rückzug!
- Du sollst feiern!
- Du sollst nicht fett werden!
- Du sollst ein sexuelles Leben haben!
- Du sollst die Initiative zurückgewinnen!
- Du sollst keine Angst haben, etwas anders zu machen als alle anderen!
- Du sollst rechtzeitig um Rat fragen!
- Du sollst deine Kinder kennen!
- Du sollst keine Angst vor einem Neuanfang haben!
Trainingsprogramm aus der Krise
Die Kurve verläuft allerdings U-förmig: Zu viele oder zu harte Schicksalsschläge machen einen psychisch anfälliger.
(Quelle: Andrea Böhnke aus DIE ZEIT No.33 / 2020)
7 Faktoren, die die Resilienz fördern:
Kostenlose Onlinetrainings zur Steigerung der Resilienz von div. Universitäten:
geton-training.de/
Resilienz in der Pandemie

Achtung Verzerrung dieser Befragung:
In der Pandemie nahmen drei Tendenzen massiv zu:
Die Enttabuisierung der psychischen Erkrankungen vor allem durch die Social Media (deshalb ist auch die Zunahme bei Jugendlichen so viel stärker).
Dann befinden wir uns im Zeitalter der Psychologisierung (Stichwort “Worried Well”)
Und die Disease Mongering, also …
Resilienz bei Abtreibungen
Als 2022 der Oberste Gerichtshof der USA entschied, jahrzehntelang geltendes Abtreibungsrecht zu kippen (auch bekannt unter der Bezeichnung “Roe vs Wade”), bezog sich das Gericht unter anderem auf wissenschaftliche Studien, die nahelegten, dass Abtreibungen das Risiko für psychische Krisen dramatisch erhöhen. Das zeigt, wie wichtig wissenschaftliche Arbeiten für die juristische Beurteilung von politischen Anliegen sind. Doch was wäre, wenn die wissenschaftlichen Arbeiten fatale Fehler enthielten?
Genau das wirft nun eine Gruppe von Wissenschaftler:innen mehreren Studien vor, die auch bei der Entscheidung 2022 eine wichtige Rolle spielten. Der Fall ist ins Rollen geraten, nachdem vor Kurzem drei Studien zurückgezogen wurden, die sich mit der Sicherheit der sogenannten Abtreibungspille Mifepristone beschäftigten. Auch sie waren in Gerichtsverhandlungen zur Gesetzeslage herangezogen worden, damit sich die Richter ein Urteil bilden.
Weitere vier Studien sehen die Wissenschaftler:innen sehr kritisch und verlangen ebenfalls, dass die Magazine, in denen sie veröffentlicht wurden, die Arbeiten zurückziehen. Da in den USA inzwischen Verhandlungen über Abtreibungen an der Tagesordnung sind, hält es die Kritiker-Gruppe für sehr wichtig, dass die Grundlage, auf der die Urteile beruhen, nicht durch Junk-Science beeinflusst wird, also durch Publikationsmüll.
Genau das seien die Studien, die herausgefunden haben wollen, dass Abtreibungen zu einem höheren Risiko für psychische Krisen führen. Denn sie hätten ernste methodische Fehler. Das sehen Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen so, darunter auch Expert:innen in biomedizinischer Statistik. Die Methoden, die in diesen Studien benutzt wurden, sind ihrer Ansicht nach nicht dazu geeignet, zu Aussagen dieser Art zu kommen.
Stattdessen sei es wissenschaftlicher Konsens, dass die psychische Gesundheit nach einer Abtreibung vor allem dadurch bestimmt ist, wie sie vor der Abtreibung war. Ausserdem seien Frauen, die ungewollt schwanger werden, immer psychisch belastet – egal ob sie abtreiben oder das Kind bekommen. Und: Frauen, die nicht abtreiben dürften, litten sowohl psychisch als auch finanziell.
(…)
In der Wissenschaft gibt es eigentlich etablierte Mechanismen, die dafür sorgen, dass Publikationsmüll entsorgt wird. Doch dieses Beispiel zeigt, dass diese Mechanismen nicht mehr greifen, wenn politische Interessen mit unlauteren Methoden durchgesetzt werden sollen. Dabei spielt auch das unsägliche Geschäftsmodell der Wissenschaftsmagazine eine bedeutende Rolle. Ein Experte schätzt, dass eigentlich eine von 50 Studien zurückgezogen werden müsste und nicht eine von 500, wie es derzeit der Fall ist.
(Quellen: Silke Jäger in forum.eu, 29.04.24 & theguardian.com/world/2024/apr/28/junk-science-papers-abortion-cases)
Lesen Sie dazu auch die verwandte Seite über die Krebsheilung! und die Verwandtschaft zum Kohärenzgefühl von Antonovsky !
…und mein Blogbeitrag über “Burnout”: walserblog.ch/2017/11/06/burnout/
Über die existentiellen “letzten Fragen” im Leben, z.B. die allgegenwärtige Angst vor dem Tode!
Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von Dr. med. Thomas Walser
Letzte Aktualisierung:
16. Mai 2024